
Die Welt im Wandel
DIE WESTLICHE WELT, Anfang der 1960er-Jahre. Ziemlich abrupt schien eine gesellschaftliche Revolution die Krusten der Tristesse, des Misstrauens und der konservativen Nüchternheit aufzubrechen zu wollen – die junge Generation hatte es einfach nicht mehr ausgehalten. Der Zweite Weltkrieg war längst vorbei, dessen Nachwehen wie auch intensivere Phasen des Kalten Krieges größtenteils überstanden und dem Nachwuchs verging so langsam aber sicher die Laune am sozialen Käfig, in dem er sich gefangen fühlte. Gehorsam, vorgepflasterte Lebenswege und ein Knigge, der die Begriffe Spaß, Individualismus und Entfaltung nicht beinhaltete.
Vier Außerirdische touren um die Welt
Technologischer Fortschritt und ein gewisser Futurismus griffen den jungen Menschen allerdings unter die Arme: Ins Fernsehen kam Farbe, Hollywood-Filme waren endlich auch in Spanien erlaubt, die kommerzielle Musik wurde poppiger und weltweit wollten die Menschen immer weniger von Pflichten und immer mehr von Möglichkeiten wissen. In den USA rebellierte Box-Superstar Muhammad Ali, der sogar mit seinem Weltmeister-Titel für seine Ideale einstand und die Jugend in ihren Absichten bestärkte: „Wenn eure Träume euch nicht erschrecken, sind sie nicht groß genug.“ Parallel strebten Amerikaner und Sowjetrussen wetteifernd nach der Reise zum Mond. Doch noch bevor es den Amerikanern 1969 gelingen sollte, kamen die Außerirdischen 1964 erst einmal zu ihnen – vier an der Zahl.
[advert]
Sie hießen John (Lennon), Paul (McCartney), George (Harrison) und Ringo (Starr), trugen alle dieselbe Frisur, dieselben Anzüge und machten verdammt viel Lärm. Sie waren Musiker, die flippig, romantisch, unbeschwert und laut waren – die schlicht und einfach den Zeitgeist trafen. „The Beatles“ aus Liverpool. Wie ein Lauffeuer verbreitete sich der Kult um das Pop-Rock-Quartett über die Westhalbkugel dieser Erde, überall wollten junge Männer so aussehen und sein wie sie, überall schrien sich junge Frauen die Kehlen heiser und fielen reihenweise in Ohnmacht.
Hysterie auch in Franco-Spanien
1965 erreichte die „Beatlemania“ auch das katholisch-ernste Spanien. Zuerst Madrid. Die Hauptstadt einer Nation, welche immerhin noch von einem Diktator – Francisco Franco – regiert wurde. Vielleicht besonders deshalb lechzte die Jugend auf der iberischen Halbinsel nach einem neuen, unbeschwerten und träumerischen Lebensgefühl, das die Beatles damals vermittelten wie kaum eine andere Erscheinung des öffentlichen Daseins. Eine Flughafenankunft, denkwürdiger als ein Staatsbesuch, das Hotel, fast von Fans gestürmt, ein Konzert in einer Stierkampfarena, von dem ältere Zeitgenossen noch heute schwärmen; Hysterie, die sich im Handumdrehen über damals große sprachliche Barrieren hinwegsetzte.
Alles, was die Beatles in den Mitt-Sechzigern anpackten, fand Anklang und wurde zu Gold. Und ähnlich war es auch mit Real Madrid, das den spanischen Fußball nach Belieben dominierte. Zwischen 1961 und 1969 hieß der spanische Meister immer Real – mit der Ausnahme 1965/66, als sich Generationswechselübersteher und Kapitän Paco Gento, „Hexer“ Amancio Amaro und Co. stattdessen aufmachten, den sechsten Henkelpott in die königliche Trophäenvitrine zu stellen.
Fußballer vermitteln den Zeitgeist
Auch wenn die Blancos übermäßig erfolgreich waren und in Sachen Popularität sicherlich noch von den Triumphen der Super-Mannschaft um Alfredo Di Stéfano profitierten, strömten die Jugendlichen und jungen Erwachsenen nicht in erster Linie deshalb begeistert in die Stadien. Die neue Generation Real Madrids bestand aus Fußballern, die das gleiche Lebensgefühl hatten und vermittelten. Sie trugen ihre Haare länger, spielten einen freien und individuellen Fußball und wollten dabei auch nicht auf ihren Spaß verzichten. In der Dribbelbewegung noch ein Hüftschwung á la Elvis Presley, bloß kein konservativ ausgeführter Pflichtsport – ein Fußballspiel hatte doch nicht anzumuten wie eine Militärparade. Nicht nur die Beatles, sondern auch die königlichen Fußballer wurden in Zentraleuropa zu einem Symbol der Mentalität der jungen Leute. Und sie bekamen einen typischen Namen.

Ein Foto, und „Yé-Yé” war endgültig geboren
Als ein paar dieser königlichen Jungspunge in Anlehnung an die englische Kult-Gruppe für ein MARCA-Cover mit den berühmten Topffrisur-Perücken posierten, war das Real Madrid „Yé-yé“ endgültig geboren – bezogen auf das Beatles-Lied „She loves you (Yeah Yeah Yeah)“. „Yé-yé“ wurden die spanischen Teenager der 1960er-Jahre von der noch etwas hüftsteifen Obrigkeit ohnehin genannt, vielmehr sogar verschrien. Es waren eben die ersten Jahre, Jahre des Aufbruchs. Beatles, Real und die “einfachen Leute” – es schien alles zueinander zu passen. Eine Epoche des Frohmuts und der Träume, ehe der Wind des Kalten Krieges in seine letzte, stürmische Phase ging.

Während das erfolgreiche Real Madrid „Yé-yé“ wie auch die legendären Beatles um 1969 ein Ende fanden, hatte eine stete Entwicklung technologisch, wirtschaftlich, aber ganz besonders gesellschaftlich dermaßen Fahrt aufgenommen, dass diese bis heute anhält. Und die Welt veränderte, nicht nur in Spanien. Die Königlichen haben ihren Anteil daran.





 0
0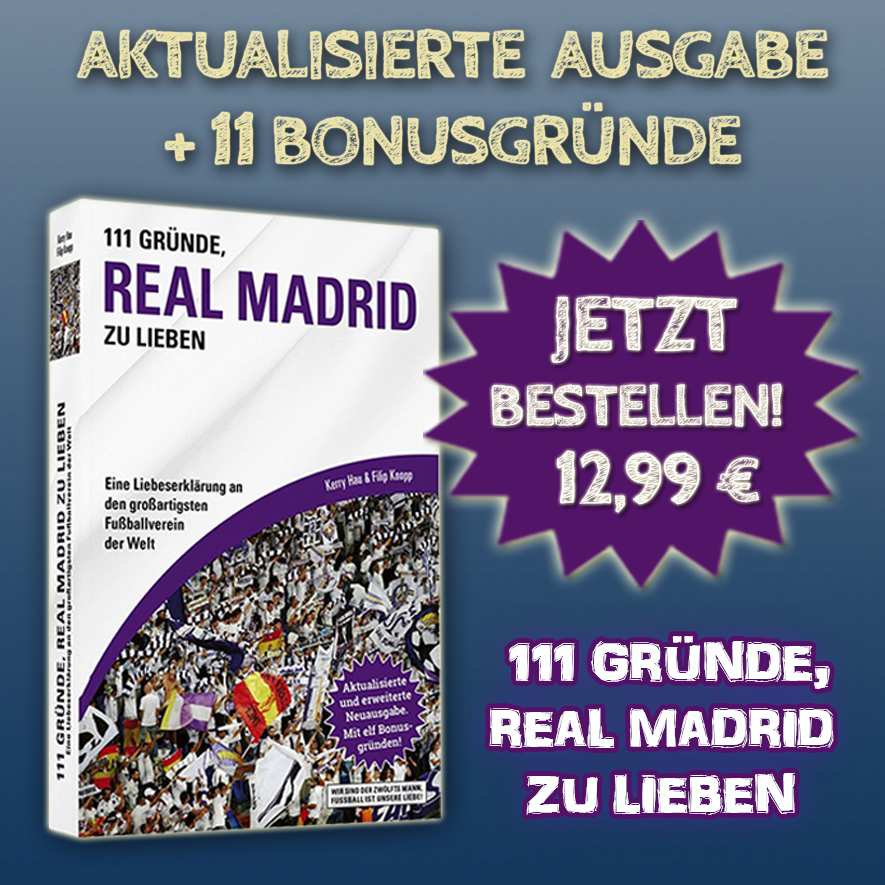
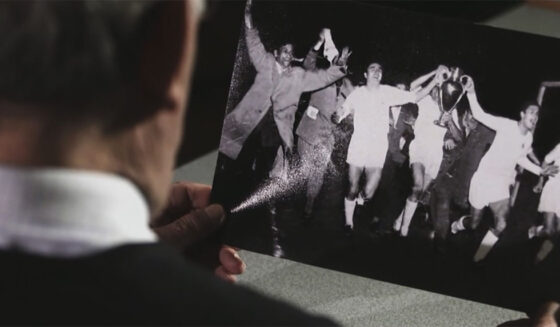




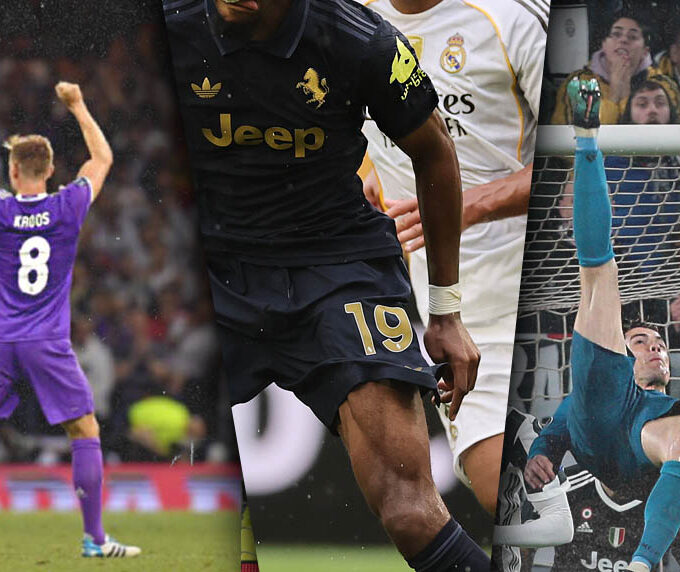


Community-Beiträge